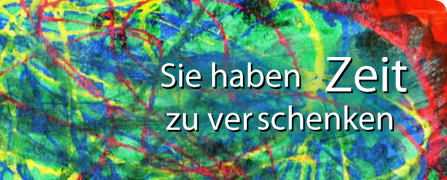Jeder Mensch muss sterben. Manche Menschen werden jedoch von schweren Krankheiten heimgesucht, die sie viel zu früh ans Sterben denken lassen. Der letzte Weg ist dann oft schwer, schmerzhaft und auch einsam. Hospize nehmen sich der Sterbenden an, pflegen sie und lindern ihre Schmerzen.
SR-online sprach mit Paul Herrlein, dem Geschäftsführer des Sankt Jakobus Hospizes in Saarbrücken und Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland e.V. über Tod, Trauer, Angst und Hoffnung.
SR-online: Herr Herrlein, könnten Sie mir ganz kurz erklären, was ein Hospiz ist?
Paul Herrlein: Hospiz kann vieles bedeuten. Unter dem Begriff Hospiz subsummiert man zuerst einmal vier Hauptbereiche: Ambulante Hospizdienste, stationäre Hospize, professionelle Symptomkontrolle zu Hause sowie Palliativstationen, die in Krankenhäusern angesiedelt sind. Im Saarland gibt es zwei stationäre Hospize, eines in Saarbrücken und das andere in Sankt Wendel. Freiwillige und Fachpersonal kümmern sich um die ambulante Betreuung der Menschen zu Hause.
SR-online: In welchem gesundheitlichen Zustand sind Menschen, die sich in Ihre Obhut begeben?
Paul Herrlein: Wenn die Menschen durch eine Hospizeinrichtung betreut werden, sind sie meistens in dem Zustand, dass sie eine schwere, zum Tode führende Erkrankung haben. Im Erwachsenenbereich ist es meistens so, dass die Lebenszeit, die ihnen bleibt, relativ kurz ist. Da spricht man von wenigen Wochen oder manchmal Monaten. Bei den schwerkranken Kindern, die wir betreuen, kann sich das auch schon mal über Jahre hinweg ziehen. Wegen der guten medizinischen Möglichkeiten ist zwar die Heilung nicht mehr möglich und die Krankheit führt auch zum Tode – meistens sind das sehr seltene Erkrankungen bei den Kindern – aber trotzdem kann das Leben verlängert werden. Doch nach einer bestimmten Zeit sterben die Kinder viel zu früh.
SR-online: Wie gehen die Patienten mit dem Bevorstehenden um?
Paul Herrlein: Die Menschen müssen damit fertig werden, dass sie nicht mehr viel Zeit haben, dass diese Situation unausweichlich ist. Zum anderen haben sie mit den ganz pragmatischen Dingen zu kämpfen, wie kriege ich meine Schmerzen los, wie werde ich richtig behandelt, wie werde ich zu Hause betreut, wie geht das mit den Kosten und es geht natürlich auch um das Spirituelle: was wird aus meiner Familie, was kommt danach, wie war mein Leben… Der Mensch stirbt als ganzer Mensch und entsprechend wird er sich auch mit allem, was sein Leben ausgemacht hat, auseinandersetzen.
SR-online: Was müssen Ihre Mitarbeiter leisten?
Paul Herrlein: Wichtig ist, dass die Teams, die schwerkranke Menschen versorgen, nie eindimensional oder in einer Profession denken, sondern immer multiprofessionell arbeiten. Es geht uns in der Hospiz- und Palliativversorgung darum, diesen ganzheitlichen Versorgungsbedarf in körperlicher, sozialer, seelischer und auch spiritueller Hinsicht gerecht werden zu können.
SR-online: Sie haben bereits die Kosten für eine solche Betreuung erwähnt. Auf was müssen sich Patienten einstellen?
Paul Herrlein: In der Regel kommen auf die Patienten keine Kosten zu. Wenn Patienten auf einer Palliativstation behandelt werden, dann ist das Teil eines Krankenhausaufenthaltes. Da gibt’s die normale Krankenhauszuzahlung. Patienten, die einen Anspruch haben, erhalten eine Überweisung in Hospize – das übernimmt die Krankenkasse. Ambulante Hospizdienste sind auf Spenden und Zuschüsse angewiesen, vom Land, vom Landkreis oder vom Regionalverband. Aber die Patienten selber müssen nichts zahlen.
SR-online: Wie würden Sie denn die finanzielle Ausstattung der Hospize beurteilen?
Paul Herrlein: Die gesamte Hospizbewegung würde nicht existieren, wenn es keine Spenden gäbe. Wir brauchen dieses bürgerschaftliche Engagement auch im finanziellen Bereich. Wir haben viele Ehrenamtliche. Im Saarland sind es mindestens 600, die sich da direkt am Krankenbett engagieren. Leider ist es so, dass die gesellschaftliche Tabuisierung des Themas „Sterben, Tod und Trauer“ nicht günstig ist für die Spendensituation bei den Hospizen. Es ist zum Teil schon sehr schwierig die Finanzierung, Jahr für Jahr hinzukriegen, dass wir vernünftig arbeiten können. Wir müssen viel über die Spenden finanzieren.
SR-online: Ihr ganzes Betreuungssystem stützt sich auf Freiwillige. Sie nennen es eine tragende Säule. Fehlen Ihnen freiwillige Mitarbeiter?
Paul Herrlein: 12.000 bis 15.000 Menschen sterben pro Jahr im Saarland. Nicht für alle ist die Palliativversorgung nötig. Aber wenn wir davon ausgehen, dass 3.000 bis 4.000 Menschen pro Jahr im Saarland eine hospizlich-palliative Versorgung brauchen und wir 600 Ehrenamtliche haben, dann sind wir in einer Situation, in der wir sagen: „Jawohl, wir brauchen ehrenamtliche Helfer!"
SR-online: Wie würden Sie die Versorgung mit Hospizen im Saarland einschätzen?
Paul Herrlein: Wir sind im Bundesvergleich ziemlich gut aufgestellt, obwohl es auch im Saarland noch erheblichen Entwicklungsbedarf gibt. Wir sind im europäischen Vergleich, wenn man zum Beispiel England nimmt, sicher in der Entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung 15 bis 20 Jahre hinten dran. Da fehlen immer noch flächendeckende Strukturen in der so genannten allgemeinen Palliativversorgung. Es fehlt an vielen Stellen die entsprechende Palliativversorgung in den Krankenhäusern und ein großer Punkt ist die Versorgung von Menschen in Altenpflegeeinrichtungen und in Pflegeheimen.
SR-online: Am 9. Oktober ist Welthospiztag. Herr Herrlein, was erwarten Sie von einem solchen Tag?
Paul Herrlein: Wir erwarten natürlich, dass eine gewisse Aufmerksamkeit auf unsere Anliegen gelenkt wird. So ein Welthospiztag muss ja nicht nur in der medialen Öffentlichkeit stattfinden. Nicht nur durch die Medien wird die Aufmerksamkeit hergestellt, sondern auch durch die Aktionen unserer Hospizdienste, unserer Einrichtungen saarlandweit. An zehn oder zwölf Standorten sind verschiedene Aktionen geplant, um auf unsere Situation und unser Thema hinzuweisen. Was wir davon erwarten ist zweierlei: Einmal natürlich, dass die Menschen erfahren, dass es uns gibt und zum anderen aber, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, dass auch ein Beitrag geleistet wird, um die Hemmschwelle oder auch die Vorbehalte oder die Ängste und die Verdrängung, die mit diesem Thema einhergeht, ein Stück weit abzubauen.
SR-online: Herr Herrlein, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Louisa Maria Giersberg.